Wie sieht die Stadtentwicklung von morgen aus und welche Rolle kann und muss Digitalisierung dabei spielen? Mit diesen und vielen weiteren Fragen sehen sich Kommunen und Stadtplaner bundesweit konfrontiert, wenn es um zukünftige Projekte geht. Nicht nur Aspekte wie Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz spielen dabei eine große Rolle, sondern auch die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger, der lokalen Wirtschaft und der Stadtverwaltung.
Mit den noch von mir in der letzten Legislaturperiode als Staatssekretär im Bundesinnenministerium mit verantworteten “Smart-City-Modellprojekten” haben mittlerweile 73 Kommunen die Möglichkeit mit Hilfe von selbst entwickelten Strategien zur nachhaltigen Digitalisierung, Antworten auf drängende Fragen zu finden.
Dabei erhalten sie neben finanziellen Mitteln auch Unterstützung beim Austausch mit anderen Modellkommunen durch die Koordinierungs- und Transferstelle Modellprojekte Smart Cities (KTS). Besonders gefreut hat mich, dass durch meine Mithilfe auch Mönchengladbach in der zweiten Staffel als Smart-City-Modellkommune ausgewählt wurde und seit Januar 2021 Fördermittel im Gesamtvolumen von 15 Millionen Euro erhält.
Mittlerweile ist die erste Phase, die Strategieentwicklung, abgeschlossen und ich habe mir gemeinsam mit unserer Ratsfrau Marion Gutsche im „Büro von morgen“ (BÜMO) von der Programmleiterin Kira Tillmanns, dem Mönchengladbacher Oberbürgermeister Felix Heinrichs und Stabsstellenleiter Michael Bahrke einen Einblick in den aktuellen Projektstand und die nun folgende zweite Phase der Umsetzung geben lassen.
Basierend auf der bereits bestehenden Stadtentwicklungsstrategie und unter Berücksichtigung der Programmrichtlinien wurden Umwelt, Mobilität und digitale Bildung und Teilhabe als die Handlungsfelder mit dem größten Potenzial identifiziert. Parallel bedarf es darüber hinaus eines grundsätzlichen Auf- bzw. Ausbaus in den Basistechnologien technische Infrastruktur, Datensouveränität und Kollaboration, um die Projekte umsetzen zu können.
Die nun durch einen Kriterienkatalog ausgewählten Projektideen wurden zuvor durch intensive Evaluation, Bürgerbeteiligung, Austausch mit anderen Modellkommunen und Beteiligung von Verwaltung und lokalen Akteuren, zum Beispiel der städtischen Wirtschaftsförderung WFMG, der Hochschule Niederrhein oder der NEW, entwickelt.
Bereits während der Phase der Strategieentwicklung wurden erste Projekte initiiert, wie der Aufbau eines Sensoriknetzes oder die Erstellung eines Digitalen Zwillings für Westend und Stadtmitte. Wenn alles planmäßig läuft, soll am Ende des Modellprojektes im Jahr 2025 dann ein Digitaler Zwilling, also eine virtuelle Darstellung, der Gesamtstadt vorhanden sein. Mit Hilfe von durch Sensoren gemessenen Daten, beispielsweise zu Temperatur, Nutzungsverhalten, Energieverbrauch oder Wetterbedingungen, lassen sich anhand dessen unter anderem Auswirkungen baulicher Maßnahmen oder Veränderungen von Verkehrsflüssen simulieren, Probleme detektieren und Verbesserung erarbeiten.
Neben diesem Projekt wird des Weiteren auch schon an einer Mobility-as-a-Service-Plattform gearbeitet, mit deren Hilfe die Mönchengladbacher Bürgerinnen und Bürger in Abhängigkeit von Tageszeit, Wochentag und Routenkriterien die passende Route per Bus, Fahrrad, zu Fuß, mit dem Auto oder per E-Scooter erhalten. Die große Vielfalt und Verfügbarkeit verschiedener Mobilitätsformen, macht eine solche mobile innerstädtische Applikation nützlich, auch um den Umstieg auf alternative Verkehrsmittel attraktiver zu gestalten.
Die aus allen bundesweit umgesetzten Projekten gewonnenen Erkenntnisse können dann Aufschluss darüber geben, wie Digitalisierung unsere Städte bereichern kann, ohne ihnen ihren Charakter zu nehmen, und dabei dennoch einen Mehrwert für die Menschen zu schaffen. Eine großartige Möglichkeit für Mönchengladbach und unser Land. Ich bin gespannt auf die weitere Umsetzung und die Ergebnisse und bedanke mich für die Einblicke in den Stand des Projektes.

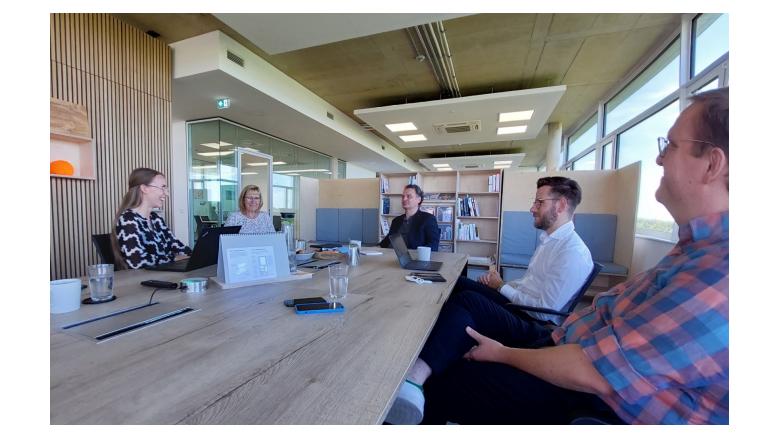




Empfehlen Sie uns!